Die neue Bundesfamilienministerin Karin Prien will bei den Problemen, die im Zusammenhang mit Social-Media-Plattform-Nutzung entstehen, neue Wege gehen. Sie setzt dabei auf ein breites Miteinander der Verantwortlichen – und will den Druck auf die Anbieter weiter erhöhen.
Bei der Vorstellung des Jahresberichts von jugendschutz.net, das im Auftrag von Bund und Ländern als Meldestelle für problematische Inhalte fungiert, erklärte die langjährige schleswig-holsteinische Bildungsministerin heute Mittag, dass sie auf einen Maßnahmenmix setze. Denn Kinder und Jugendliche hätten sowohl ein Recht auf Schutz als auch auf altersgerechte Teilhabe. Sie sehe dabei massiven Handlungsbedarf.
Die von jugendschutz.net vorgelegten Zahlen betrachte sie als "in Teilen alarmierend". 17.630 Verstöße gegen das Jugendmedienschutzrecht registrierte jugendschutz.net 2024, fast 90 Prozent betreffen laut der Stelle Darstellungen sexualisierter Gewalt.
Zunehmend würde dabei ein neuer Trend eine Rolle spielen, sagte Stefan Glaser, Leiter der Institution, in Berlin: "Generative KI ist im Alltag angekommen." Das betreffe beim Kinder- und Jugendschutz etwa die Deep-Nude-Problematik, wenn normale Bilder per KI zu vermeintlichen Nacktbildern von Menschen verarbeitet werden.
Doch auch in anderen Bereichen könne seine Stelle keine Entwarnung geben. 1.087 Mal erhielt jugendschutz.net etwa Kenntnis von extremistischen Inhalten. Glaser warnte zudem vor Köder-Angeboten an Jugendliche und Kinder im Gaming-Umfeld: Vor allem auf Discord versuchten Extremisten, mit Minderjährigen in Kontakt zu kommen. Auf anderen Plattformen versuchten etwa islamistische Influencer über Lifestyle-Themen vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund anzusprechen.
Schutzmaßnahmen der Betreiber seien zwar von der Intention her richtig, aber meist wirkungslos. "Solange das Alter nicht verlässlich geprüft wird, fehlt den Maßnahmen der Impact", sagte Glaser. Solange Nutzer ein beliebiges Alter angeben könnten, wären Schutzmaßnahmen, die darauf basierten, unzureichend.
KJM fordert wirksame Altersverifikation
Deutlich härter ins Gericht mit den Anbietern ging Marc-Jan Eumann, der Vorsitzende der Kommission für den Jugendmedienschutz der Länder. Er nannte als ein Beispiel für unzureichende Bemühungen die Teen-Konten bei Instagram, bei denen Elternkonten mit denen ihrer Kinder bis zum 16. Lebensjahr verknüpft werden und als Voreinstellung Beschränkungen der Kontaktaufnahme und der sichtbaren Inhalte aufnehmen.
Für Eumann ist die Funktion, die seit vergangenem September zur Verfügung steht, "am Ende eine Nebelkerze einer Anbieterin, vorzugaukeln, dass es in ihrem Angebot einen Schutz gibt." Eumann ist starker Verfechter von Altersverifikationssystemen, wie sie der DSA auch grundsätzlich anlegt. Die seien marktreif verfügbar – und er traue den Plattformen auch zu, diese praxistauglich einzusetzen. "Sie tun es nur nicht, weil es ihr Geschäftsmodell gefährdet", sagte Eumann.
Die für Jugendmedienschutz zuständigen Bundesländer wollen mit der nächsten Überarbeitung des entsprechenden Staatsvertrages hier weitere Pflichten festzurren und Altersverifikationssysteme auf Betriebssystemebene verankern. Ob die Pläne der Staatskanzleien mit Europarecht vereinbar sind, ist dabei umstritten. Doch Technik allein wird es in jedem Fall nicht richten.
Zur Problematik der neuen KI-Missbrauchs-Möglichkeiten hat der KJM-Vorsitzende Eumann eine eindringliche Bitte an Eltern parat: "Gehen Sie davon aus, dass jedes Bild, das im Netz erscheint, irgendwann einmal missbraucht wird." Die Fantasie derjenigen, die damit etwas generieren wollten, sei nahezu unbegrenzt.
Eumann wiederholte seinen bereits in der Vergangenheit ausgesprochenen Appell an die Erwachsenen: "Stellen Sie niemals ein unverpixeltes Bild ihres Kindes ins Netz. Erst recht nicht mit dem Namen und dem Alter."
Die Diskrepanz zwischen analogem und digitalem Verhalten der Eltern würde ihn irritieren. Während in der analogen Welt Kinder stark behütet bis zur Schultür gebracht würden, würden sie in der digitalen Welt weitgehend alleingelassen.
Prien: Eltern spielen ganz entscheidende Rolle
Der Schutz der jungen Generation in der digitalen Welt sei sowohl eine pädagogische als auch eine politische Aufgabe, erläuterte Prien, die im Bund seit Anfang dem Bundesministerium für Bildung, Familien, Senioren, Frauen und Jugend vorsteht. Das Smartphone sei zum einen für die Teilhabe wichtig – aber eben auch ein Weg, über den pornografische, extremistische und andere problematische Inhalte die Jugendlichen erreichten.
Rassismus, Antisemitismus, Frauenverachtung seien auf Plattformen verbreitet. Sie fordert daher: "Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Inhalte in sogenannten sozialen Netzwerken meinungsbildend werden."
Insbesondere den Kinder- und Jugendschutzvorschriften im Digital Services Act misst Prien dabei Gewicht bei. Die Bundesregierung werde sich gegenüber der EU-Kommission für eine wirksame Durchsetzung einsetzen. Zugleich gehe es nicht nur um Regulierung und Gesetze, sondern auch um Medienkompetenz. "Dabei spielen die Eltern eine ganz entscheidende Rolle", sagte Prien, auch wenn Schulen und Kindergärten und -tagesstätten ebenfalls eine wichtige Rolle zukäme. Bereits als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein hatte Prien ein allgemeines Mobiltelefonverbot für Schüler in der Grundschule durchgesetzt, die dort die ersten vier Klassen umfasst.
Unter Verweis auf neue Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) problematisierte sie die insgesamt vergleichsweise hohe Bildschirmzeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Die Auswirkungen davon sollen wissenschaftlich analysiert werden, kündigte Prien zudem an. Für sie aber sei klar: "Bis drei Jahre haben digitale Endgeräte bei Kindern in keinem Kontext irgendetwas zu suchen."
Dass mit der neuen Bundesfamilienministerin hier eine etwas andere Schwerpunktsetzung Einzug in die Debatte hält, zeichnete sich bei der heutigen Pressekonferenz in Berlin ab: Prien hat angekündigt, dass eine umfassende Strategie für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt erarbeitet werden solle. Mehrfach betonte sie, dass wissenschaftliche Erkenntnisse als Leitlinie auch für politisches Handeln gelten sollen.
Der Schutz der jungen Generation in der digitalen Welt sei dabei eine gesamtgesellschaftliche, eine pädagogische und eine politische Aufgabe. Sie setze dabei zusätzlich zu DSA und deutschen Rechtsnormen unter anderem auf den derzeit für 2026 erwarteten "Digital Fairness Act"-Vorschlag der EU-Kommission, mit dem der Rechtsrahmen für Onlineangebote noch einmal angegangen werden soll.
(wpl)








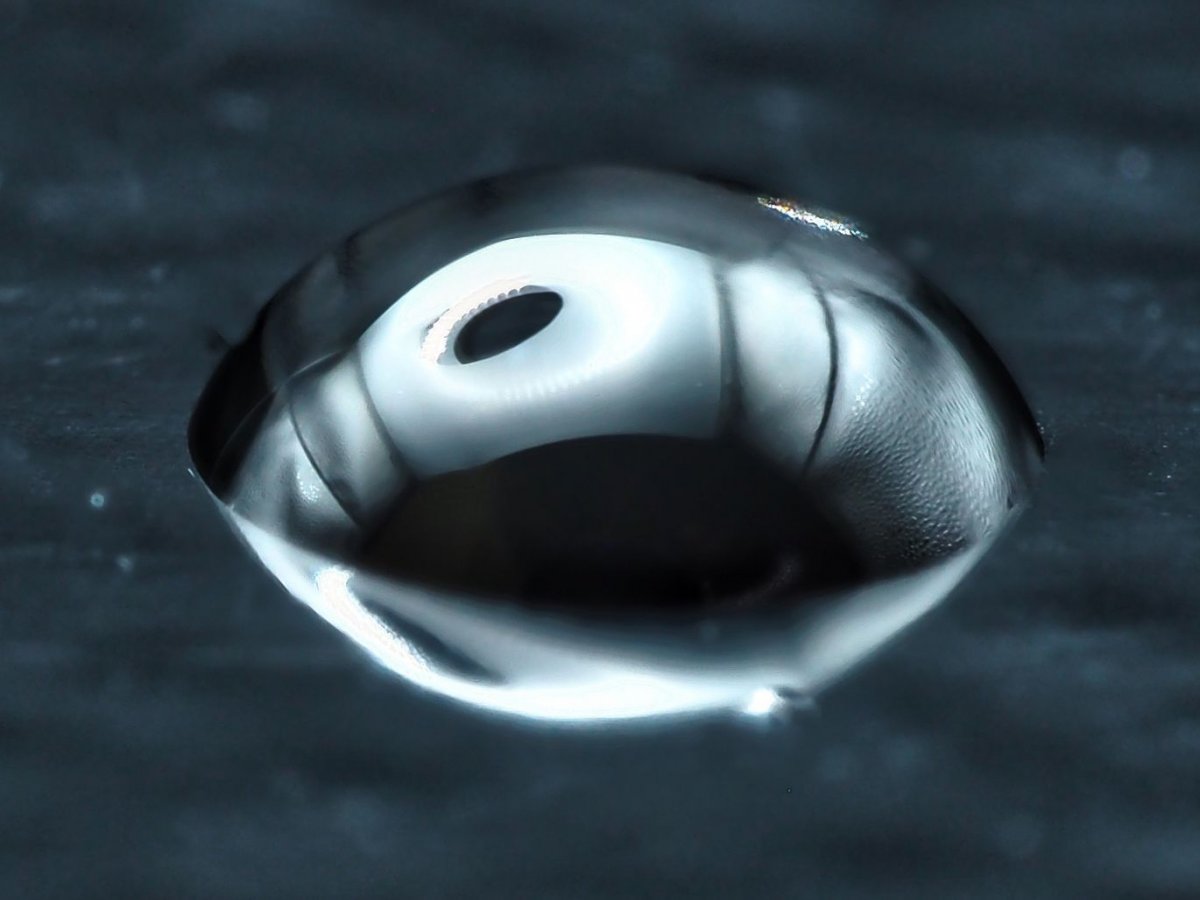


 English (US) ·
English (US) ·