Auf die Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) war lange gewartet worden. Am Freitag nun hat das BfV die gesamte AfD nach mehrjähriger Prüfung als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die AfD-Bundessprecher Alice Weidel und Tino Chrupalla (Bild oben) kritisierten die Hochstufung ihrer Partei als politisch motiviert und kündigten an, sich juristisch dagegen zur Wehr zu setzen.
Nun ist die Debatte wieder voll entbrannt: Soll es ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht geben? Was ist mit der Parteienfinanzierung? Gibt es Auswirkungen für AfD-Mitglieder im Staatsdienst? Und natürlich: Wie verhält sich Friedrich Merz (CDU), der am Dienstag zum Bundeskanzler gewählt werden soll. Ausländische und inländische Medien bewerten die Einstufung der AfD und die Folgen für die deutsche Politik. Hier eine Auswahl der Pressestimmen von der Nachrichtenagentur dpa:
NIEDERLANDE
„De Telegraaf“: Die Nachricht schlug wie eine politische Bombe ein. Denn der Zeitpunkt der neuen Einschätzung zum „politischen Risiko“ der rechtsextremen Partei ist heikel. Der Verfassungsschutz hatte nämlich zunächst bis nach den vorgezogenen Neuwahlen im Februar gewartet, damit die Wähler „neutral abstimmen“ konnten. Doch nun erfolgte die Bekanntgabe nur wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen konservativen Bundeskanzlers Friedrich Merz.
Der CDU-Chef hatte zuvor ein Türchen für die AfD geöffnet, ebenso wie sein künftiger Fraktionsvorsitzender Jens Spahn. Diese Christdemokraten mussten dann jedoch angesichts der öffentlichen Meinung und erheblicher Proteste zurückstecken. Inzwischen steht die „Brandmauer“ aller deutschen Parteien gegen die euroskeptische AfD wieder fest.
GROSSBRITANNIEN
„Guardian“: Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte, es habe keinen politischen Einfluss auf die Einschätzung des Verfassungsschutzes gegeben, während die AfD das Gegenteil behauptet. Aber der Schritt setzt die neue konservativ geführte Regierung von Friedrich Merz unter großen Druck, ebenso wie Faesers sozialdemokratische Kollegen, die Juniorpartner in der neuen Koalition sein werden, die am kommenden Dienstag ihre Arbeit aufnehmen soll.
Merz wird nun – zusätzlich zu den unzähligen anderen Herausforderungen, die er zu bewältigen hat – entscheiden müssen, ob die AfD verboten werden soll und wenn ja, wie das erreicht werden soll, was eine höchst prekäre politische Gratwanderung darstellt.
Migration, Ukraine, Trump und eine kränkelnde Wirtschaft sind nur einige der Probleme, die er ebenfalls mit Dringlichkeit angehen muss. Die wachsende Unzufriedenheit hinsichtlich dieser und anderer Themen, die durch den monatelangen politischen Stillstand nach dem Zusammenbruch der vorherigen Regierung noch verschärft wurde, hat die AfD in den Umfragen in die Höhe schnellen lassen.
SCHWEIZ
„Tages-Anzeiger“: Das Verbot der rechtsextremistischen NPD scheiterte einst, weil diese laut Gericht zu klein und zu unbedeutend war, um die Demokratie zu gefährden. Bei der AfD könnte es nun umgekehrt sein: Sie ist für ein Verbot eigentlich schon zu groß.
Mehr als zehn Millionen Deutsche haben bei der letzten Wahl die AfD gewählt; laut Umfragen ist diese derzeit sogar stärkste Partei im Land – gleichauf mit der Union oder knapp vor ihr. Viele ihrer Wählerinnen und Wähler sind selbst keine Rechtsextremisten; sie trauen es den anderen Parteien nur nicht mehr zu, ihre Probleme zu lösen. Vom Stigma „rechtsextremistisch“, das in Deutschland politisch lange tödlich war, lassen sie sich längst nicht mehr abschrecken.

© Reuters/Eva Manez
Man müsse die AfD mit besserer Politik „wegregieren“ statt „wegverbieten“, meint eine Mehrheit bei CDU, CSU und FDP. Viele bei der SPD und den Grünen sehen es gleich. Zu Recht wenden sie ein, dass auch ein Verbot das Grundproblem nicht lösen würde: dass nämlich viele Deutsche den „Altparteien“ und „dem Staat“ nicht mehr vertrauen. Die Vorstellung, diese Menschen würden brav wieder CDU oder SPD wählen, sobald die AfD verboten wäre, ist abstrus.
„Neue Zürcher Zeitung“: Die lange erwartete und letztlich wenig überraschende Entscheidung des Inlandsgeheimdienstes wird eine Kaskade von Entwicklungen in Gang setzen, an deren Ende die politische Polarisierung Deutschlands auf die Spitze getrieben sein wird. Das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in die Demokratie dürfte hingegen einen neuen Tiefpunkt erreichen. Diese Entscheidung könnte einen Teil der Wähler dauerhaft vom Staat entfremden.
Besonders in Ostdeutschland ist eine Trotzreaktion zu erwarten, die im vierten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung die geistige Mauer zwischen den beiden Landesteilen wieder anwachsen lassen wird. (…)
Manche Sympathisanten und Wähler der Partei dürfte die Einstufung beeindrucken, andere nicht. Die Partei selbst wiederum könnte sich mäßigen oder radikalisieren. So oder so ist die Entscheidung des Inlandsgeheimdienstes ein massiver Eingriff in die deutsche Demokratie. Sie weist den Weg in eine politische Sackgasse. Wie die Bundesrepublik daraus wieder herausfinden soll, ist nicht zu erkennen.
ITALIEN
„Corriere della Sera“: Dass die Partei allen Grund bietet, als extremistisch eingestuft zu werden, ist unbestritten. Die Radikalisierung wurde von ihren führenden Politikern, angefangen bei Alice Weidel, in vollem Bewusstsein gezielt betrieben. Aber weder ein Geheimdienstbericht noch ihre Marginalisierung im Bundestag werden die AfD besiegen. Wie Shakespeare sagte: „Der Fehler liegt nicht in unseren Sternen, sondern in uns selbst.“
Ohne konkrete Antworten der neuen Regierungskoalition auf die Sorgen und Ängste der Bürger, vor allem auf die illegale Einwanderung, wird es schwierig sein, den Zulauf für die AfD stoppen zu können. Das ist vor allem ein Test für die SPD, die in dieser Frage darauf bedacht zu sein scheint, den neuen Kanzler zu bremsen.
DEUTSCHLAND
„Südwest Presse“: Mit der Einstufung stellt sich auch die Frage neu, ob der Bundestag einen Antrag auf Verbot der Partei stellen sollte oder nicht. Das unter Verschluss gehaltene Gutachten dürfte die Verbots-Befürworter in ihrer Meinung bestätigen. Ihre Argumente erhalten jedenfalls dadurch neue Nahrung.
Allerdings ändert das Gutachten nichts an der grundsätzlichen Einschätzung, dass politische Gegner nicht verboten, sondern politisch bekämpft gehören. Die neue schwarz-rote Regierung kann das schaffen – und das wäre allemal besser als ein Verbot.

© dpa/Hannes P Albert
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: Es ist eine Binsenweisheit, dass die Arbeit des Verfassungsschutzes „politisch motiviert“ sei. Der Schutz der Verfassung hat schließlich eminent staatspolitische Motive. (…) Weil die Partei nicht vor der eigenen Tür kehren will (könnte es nicht sein, dass die Gerichte recht haben?), war es nur eine Frage der Zeit, dass sie auch die Justiz als Büttel des Establishments hinstellt.
Zur Abrundung ihrer Staatskritik fehlte der AfD bislang nur noch, was jetzt eingetreten ist. Die AfD stellt die mit Abstand größte Oppositionsfraktion im Bundestag. Das Dilemma der wehrhaften Demokratie wird, da diese Opposition als gesichert rechtsextremistisch gilt, noch einmal größer. Konsequentes Handeln liefe auf ein Verbotsverfahren hinaus. Oder man toleriert, was die wehrhafte Demokratie nicht tolerieren darf.
„Augsburger Allgemeine“: Fast auf den Tag genau 80 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft stuft der Verfassungsschutz die größte deutsche Oppositionspartei als rechtsextremistisch ein. Man sollte das kurz sacken lassen. Natürlich muss ein AfD-Verbot deshalb noch lange nicht richtig sein. Die Hürden für ein Parteiverbot sind zu Recht hoch. Aber es sollte zumindest geprüft werden. Alles andere wäre vor dieser historischen Kulisse verantwortungslos.
„Kölner Stadtanzeiger“: Hier hat sich eine Partei etabliert, die den politischen Gegner als Feind begreift, das System als Ganzes infrage stellt und damit auch Zusammenleben in der liberalen Demokratie. Das Gutachten des Verfassungsschutzes hätte nicht anders ausfallen können.
Für die AfD-Verbotsdebatte ist die Hochstufung ein Booster – und hier liegt die größte Gefahr. Ein solches Verfahren dauert viele Jahre, aber schon 2026 wird in fünf Bundesländern gewählt. Eine Verbotsdebatte muss vom Wahlkampf getrennt geführt werden. Die Wahlergebnisse werden ein Zeichen setzen: Wie viele Menschen werden ihr Kreuz bei einer Partei machen, vor der nun in der schärfsten Form gewarnt wird. Mit anderen Worten: Wer vertraut noch unserer Demokratie?
„Handelsblatt“: Die Wählerinnen und Wähler hat die verfassungsfeindliche Entwicklung der Partei bisher nicht weiter gestört. Im Gegenteil – die AfD ist im Bundestag zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen – und hat in einzelnen Umfragen die Union sogar schon überholt. Das alles darf aber nicht davon abhalten, den Staat wehrhaft gegen die Partei in Stellung zu bringen.
Wer erwiesenermaßen Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verfolgt, darf sich nicht wundern, wenn der Rechtsstaat alles tut, um diese Grundordnung zu verteidigen. Und dazu gehört nun ohne Zweifel, dass ernsthaft ein Verbotsverfahren gegen die AfD geprüft wird. (…)
Entscheidend wird nun sein, wie sich die neue schwarz-rote Koalition positioniert. Der Umgang mit der AfD muss einvernehmlich geklärt werden. Eine Normalisierung des Verhältnisses zu der Partei, wie zuletzt vom designierten Unionsfraktionschef Jens Spahn angeregt, ist nicht zielführend.
„Weser-Kurier“: Eines wird allerdings nicht stattfinden: ein kritisches Nachdenken, ob vielleicht nicht der Einfluss der Kräfte um Björn Höcke in den vergangenen Jahren zu groß geworden ist (…)
Dieser Prozess hat in der AfD bisher nicht stattgefunden: weder nach der Berichterstattung über den Einfluss von rechtsextremen und identitären Kreisen noch nach den diversen Parteispendenskandalen, weder nach Aufdeckung der Russland- und China-Verstrickungen noch nach den Gerichtsurteilen, die die Partei in der Vergangenheit als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hatten. Fehlverhalten sieht die AFD immer nur bei allen anderen, nie bei sich selbst.
„Rhein-Zeitung“: Ob die Einstufung der AfD politisch schaden wird, steht auf einem anderen Blatt. Derzeit ist sie die führende Kraft in vielen Umfragen – vielleicht nur eine Momentaufnahme in Zeiten des Regierungsvakuums –, aber sie ist auf jeden Fall eine politische Größe. In den drei ostdeutschen Ländern hatte die bereits vorliegende Einstufung als gesichert rechtsextremistisch bei der zurückliegenden Bundestagswahl jedenfalls nicht geschadet.
Die neue schwarz-rote Regierung muss sich jetzt darauf konzentrieren, die Wirtschaft in Schwung und die Migration in den Griff zu bekommen und die soziale Frage ehrlich zu beantworten. Es muss darum gehen, die Erfolge der AfD ernst zu nehmen, deren Wähler nicht zu dämonisieren, die Partei aber auch nicht zu relativieren.

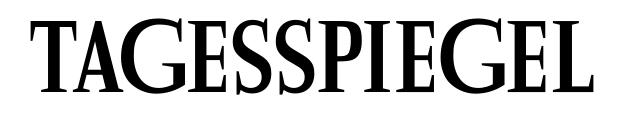 vor 15 Stunden
1
vor 15 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·