1. Wunde Republik Deutschland
Politisch motivierte Straftaten gelten als Indikator gesellschaftlicher Konflikte. Zieht man die jüngsten Zahlen in Deutschland heran, scheint die Basis des zwischenmenschlichen Zusammenlebens immer weiter zu erodieren.
2024 wurden laut Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt mit über 84.000 Fällen so viele politisch motivierte Straftaten wie nie zuvor erfasst – ein Anstieg um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark stiegen die Zahlen im rechten Spektrum (42.788 Fälle, plus 50 Prozent), in dem nun jede zweite Tat stattfindet. Auch Delikte mit ausländischer (7.343) und religiöser Ideologie (1.877) erreichten Rekordwerte, meist im Zusammenhang mit Nahostkonflikt und Islamismus. Linke Straftaten (9.971) und »Sonstige« (22.193) nahmen ebenfalls zu, blieben aber unter bisherigen Höchstständen.
Sachbeschädigungen und Propagandadelikte machten 2024 rund 60 Prozent aller Taten aus. Viele Straftaten stehen im Zusammenhang mit Wahlen (11.800 Fälle), etwa indem Wahlplakate beschädigt oder zerstört wurden. Die Zahl der Gewalttaten stieg um 15 Prozent, besonders im Bereich »ausländische Ideologie«. Opferberatungsstellen verzeichnen ebenfalls mehr rechte Angriffe, meist rassistisch motiviert. Auch internationale Krisen beeinflussen zunehmend die Sicherheitslage in Deutschland.
Der Anstieg wird durch bessere Erfassung, insbesondere im Internet, begünstigt, schreiben meine Kollegen Philipp Kollenbroich, Levin Kubeth und Wolf Wiedmann-Schmidt. Es scheint sich im Kleinen zu spiegeln, was sich im Großen schon länger abzeichnet: Differenzen löst man nicht mehr im Gespräch, sondern auf dem Schlachtfeld . Wenn Staaten nicht mehr miteinander reden, warum soll ich es dann mit meinem politisch andersdenkenden Nachbarn tun? Am Anfang war das Wort, am Ende im schlimmsten Fall der Mord.
Lesen Sie hier die Analyse: Höchststand bei politisch motivierten Straftaten in Deutschland – was dahintersteckt
2. Die EU als Paketzusteller
Nach dem Telefonat zwischen Russlands Machthaber Putin und dem amerikanischen Präsidenten Trump herrscht allerorten Ernüchterung, außer in Moskau und Washington. »Wladimir Putin spielt offenbar weiter auf Zeit«, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Man müsse Putin an seinen Taten messen und nicht an seinen Worten. »Er ist nach wie vor nicht zu Zugeständnissen bereit«, so der SPD-Politiker. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas kritisierte, Russland wolle »offensichtlich« keinen Frieden mit der Ukraine. Die EU wolle nun »Konsequenzen sehen, auch vonseiten der USA«.
Heute zog die EU zumindest selbst Konsequenzen. Sie setzte das 17. Sanktionspaket gegen Russland in Kraft, um den Druck auf Putin zu erhöhen . Im Mittelpunkt stehen verschärfte Maßnahmen gegen die sogenannte russische Schattenflotte , die Öl und Ölprodukte transportiert. Rund 200 weiteren Schiffen wird der Zugang zu EU-Häfen untersagt, und zahlreiche Unternehmen, die an der Umgehung bestehender Sanktionen beteiligt sind oder die russische Rüstungsindustrie unterstützen, werden ins Visier genommen.
Auch der Preisdeckel für russisches Öl könnte weiter gesenkt werden. Ein 18. Sanktionspaket ist bereits in Planung, das unter anderem die Wiederaufnahme des Betriebs der Nord-Stream-Gaspipelines verhindern soll. Auch Großbritannien hat zusätzliche Sanktionen gegen den russischen Militärsektor, Energiesektor und den Finanzsektor angekündigt, als Reaktion auf massive russische Drohnenangriffe auf die Ukraine.
16 Sanktionspakete haben Putin bislang weder zum Nachdenken, noch zum Einlenken gebracht. Kaum vorstellbar, dass es nun Nummer 17 und 18 tun.
Lesen Sie hier mehr zu den Sanktionen: Gegen Russlands Schattenflotte – EU setzt Sanktionspaket Nummer 17 in Kraft
3. Wo Schlepper nützlich sind
Am Samstag kollidierte das mexikanische Segelschulschiff »Cuauhtémoc« beim Auslaufen aus New York mit der Brooklyn Bridge. Alle drei Masten brachen ab, zwei Crewmitglieder starben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Als Unfallursache wurde eine Verkettung aus starker Strömung, Wind und vermutlich einem Maschinenschaden angegeben: Das Schiff wurde manövrierunfähig rückwärts auf die Brücke getrieben. Doch Experten bezweifeln, dass das Unglück unausweichlich war.
Mein Kollege Claus Hecking hat mit dem früheren Präsidenten des Bundesverbands der See- und Hafenlotsen, Gerald Immens, gesprochen. Er kritisiert, dass der Schlepper zu früh entlassen wurde – ein längeres Festhalten hätte das Unglück wahrscheinlich verhindert, ohne Mehrkosten zu verursachen. Auch wurde der Anker nicht geworfen, was für den Experten rätselhaft bleibt .
Zum Zeitpunkt des Unfalls standen viele Kadetten traditionell in der Takelage, gesichert mit Gurten, was wohl Schlimmeres verhinderte. »Wenn die gefallen wären, egal ob aufs Deck oder aufs Wasser, wären sie womöglich auch gestorben. Wie gut, dass so viele Gurte gehalten haben«, so Immens.
Die »Cuauhtémoc« ist nach Plänen der deutschen »Gorch Fock« gebaut und der Stolz der mexikanischen Marine. Nach Abschluss der Untersuchungen könnte das Schiff repariert werden, der materielle Schaden mag überschaubar sein, der Imageschaden aber groß.
Lesen Sie hier das vollständige Interview: »Den Schlepper länger am Schiff zu lassen, hätte das Unglück ziemlich sicher verhindern können«
Was heute sonst noch wichtig ist
Olaf Lies zum Ministerpräsidenten von Niedersachsen gewählt: Stephan Weil hatte das Amt des Landeschefs aus persönlichen Gründen abgegeben, nachfolgen sollte ihm der bisherige Wirtschaftsminister Olaf Lies. Die erforderliche Mehrheit übertraf er klar.
Ministerin Prien will Lohnersatz für pflegende Angehörige einführen: Die Erwerbsarbeit eine Zeit lang hintanstellen, der Staat zahlt einen Lohnersatz: Was es für Eltern schon lange gibt, sollen laut Familienministerin künftig auch pflegende Angehörige bekommen – mit einer Einschränkung.
Deutschland erzielt im Handel mit den USA großen Exportüberschuss: Es sind Zahlen wie diese, die den US-Präsidenten erzürnen: Die Bundesrepublik hat in den ersten drei Monaten des Jahres Waren im Wert von vielen Milliarden Euro mehr in die USA exportiert als von dort importiert.
Frankreich, Großbritannien und Kanada drohen Israel wegen Gazaoffensive: Die Rede ist von einer »völlig unverhältnismäßigen« Eskalation: Paris, London und Ottawa verurteilen das israelische Vorgehen in Gaza und erwägen Sanktionen. Eine Antwort aus Israel kommt prompt.
Meine Lieblingsgeschichte

Übergabe per Schlüsselsafe: Sicheres Indiz für Airbnb
Foto: Mike Kemp / In Pictures / Getty ImagesFür viele Reisende ist Airbnb längst eine gängige Plattform, um nach Unterkünften zu suchen, auch für mich. In Spanien dürfte das Angebot nun knapper werden. 65.000 der über 400.000 dortigen Airbnb-Unterkünfte verstoßen gegen spanisches Recht und müssen gelöscht werden – auch weil die Touri-Bleiben missbräuchlich Wohnraum für Einheimische verknappen. Meine Kollegen Abdul Rahmatullah, Sebastian Stoll und meine Kollegin Julia Stanek haben zusammengetragen, wie man Privatunterkünfte finden kann, ohne Schuldgefühle zu entwickeln.
Lesen Sie hier die ganze Geschichte: So gelingt der Städtetrip ohne schlechtes Gewissen
Was heute weniger wichtig ist
Lipabekenntnisse : Auf ihrer Welttournee überzeugt Dua Lipa,29, nicht nur mit Tanzeinlagen und einer spektakulären Show. Der Popstar spricht und singt auf Spanisch, Französisch und Deutsch. In Hamburg begeistert sie neben Fans aus dem SPIEGEL-Nachrichtenressort auch Tausende weitere mit Nenas »99 Luftballons«. »Heute Abend werde ich versuchen, auf Deutsch zu singen. Wenn ihr dieses Lied kennt, singt mit.«
Mini-Hohlspiegel

Angebot in einem Fischlokal in List auf Sylt (Schl.-Holst.)
Hier finden Sie den ganzen Hohlspiegel.
Cartoon des Tages

Entdecken Sie hier noch mehr Cartoons.
Thomas Plaßmann

Roswitha Quadflieg
Foto: MaurizioxGambarini / Funke Foto Services / IMAGOAls der Jahrhundertschauspieler Will Quadflieg 2003 starb, schrieb der SPIEGEL. »Er faszinierte mit Stimme und Ausstrahlung.« Seine Stimme blieb aber stumm, wenn es um seine Zeit im Nationalsozialismus ging, nach dessen Ende er seine Karriere nahtlos fortsetzen konnte. Seine Tochter Roswitha stieß nun auf Tagebücher, die Quadflieg in den Jahren 1945/1946 schrieb. Er richtete die Worte an seine Frau – eine Schwedin, die in den letzten Kriegsjahren in ihre Heimat floh.
Die Tochter hoffte, etwas mehr über das Seelenleben des Vaters zu erfahren, wurde aber enttäuscht. Roswitha Quadflieg rekonstruiert 104 Tage im Leben ihres Vaters und konfrontiert ihn posthum damit. Sie stellt ihm die Frage, warum er nur berichtet, was ihm direkt in seinem Umfeld begegnete, obwohl er sehr genau von der Existenz der Konzentrationslager wusste. Sie will wissen, warum er nur Mitleid für die Deutschen hatte, nicht aber für ihre Opfer, und warum er glaubte, mit etwas mehr Hölderlin die Schlacht gewinnen zu können. Aus dem imaginären Zwiegespräch entstand das im Kanon-Verlag erschienene Buch »Ich will lieber schweigen«. Quadflieg war kein Mitläufer, aber »ein Vorbeiläufer«, wie Roswitha Quadflieg im WDR bilanzierte. Dieses Buch könnten Sie sich heute besorgen.
Einen schönen Abend. Herzlich
Ihr Janko Tietz, Ressortleiter Nachrichten

 vor 3 Stunden
1
vor 3 Stunden
1








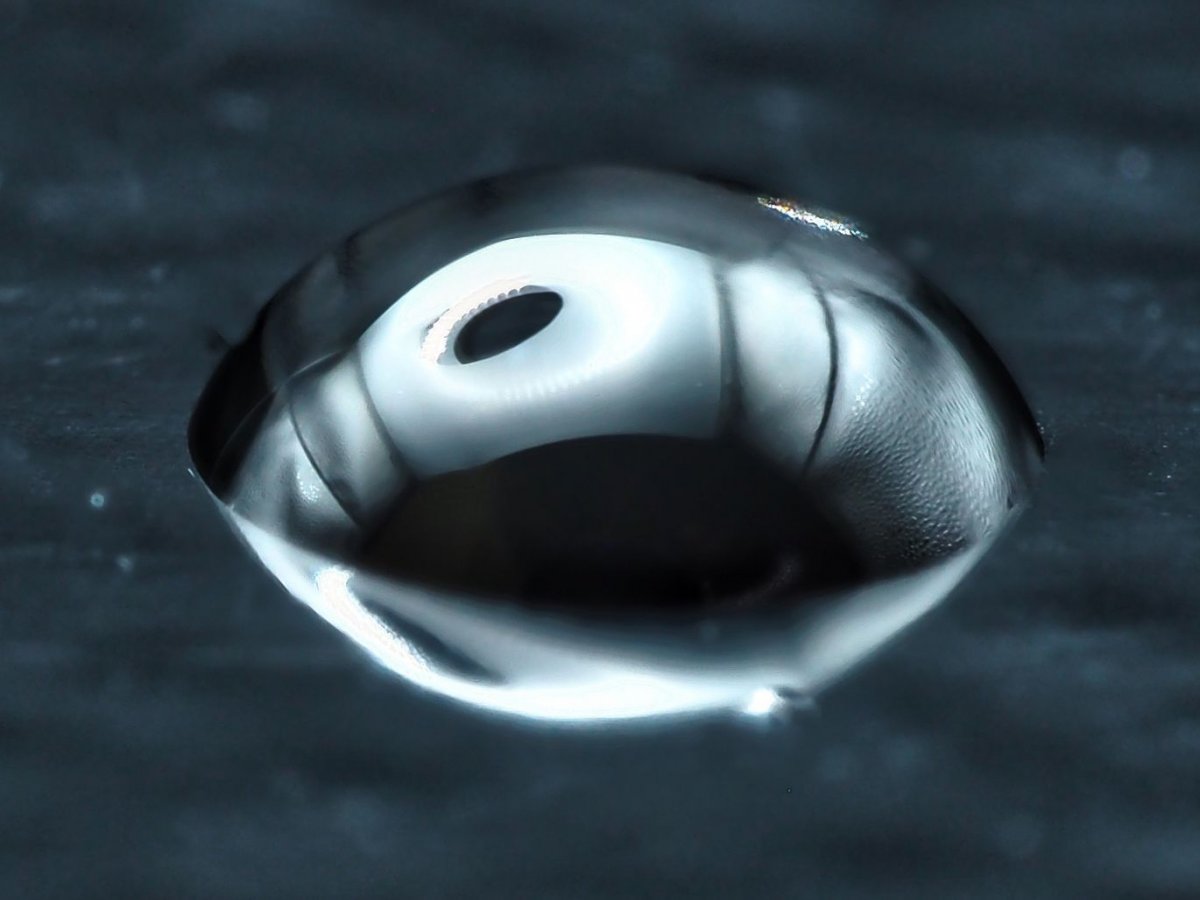


 English (US) ·
English (US) ·