Therese von Brunswick (auch: Brunsvik) ist allen Beethoven-Liebhabern bekannt als Widmungsträgerin der Klaviersonate Fis-Dur op. 78, der „Theresen-Sonate“. In Ungarn wird sie fast als Nationalheilige verehrt und ihr 250. Geburtstag am 27. Juli groß gefeiert. Ihre Bedeutung sehen viele auf einer Höhe mit dem Staatsreformer und Ökonomen István Széchenyi, der Ungarn ökonomisch und politisch im neunzehnten Jahrhundert ertüchtigte, um es durch Rationalität, nicht aus romantischem Überschwang, reif zu machen für die Selbständigkeit gegenüber Österreich.
Therese von Brunswick aber ist die große Pionierin des Bildungswesens. Als Anhängerin des Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi hatte sie am 1. August 1828 in Buda, dem westlichen Stadtteil des heutigen Budapest, den „Angyalkert“, also den „Engelsgarten“ gegründet, Ungarns ersten Kindergarten, und verfolgte die Verbreitung der ungarischen Sprache als pädagogisches Ziel.
Therese von Brunswick und ihre vier Jahre jüngere Schwester Josephine waren von ihrer Mutter Anna im Mai 1799 nach Wien gebracht und Klavierschülerinnen des achtundzwanzigjährigen Ludwig van Beethoven geworden. Der Komponist und Pianist war von deren musikalischer Hochbegabung wie Schönheit so hingerissen, dass er den Unterricht unentgeltlich erteilen wollte und sich in Josephine sofort verliebte. Es sollte eine ebenso inspirierende wie tragische Liebe werden, die bis zu Josephines Tod 1821 andauerte und von der die Nachwelt erst 1957 erfuhr, als plötzlich dreizehn leidenschaftliche Liebesbriefe Beethovens an Josephine auftauchten.
Vom Himmel füreinander bestimmt
Dass Therese eine Verlobung mit Beethoven einging, die wieder gelöst wurde, geschah vermutlich nur zum Schein, um die vertrauliche Nähe zwischen Beethoven und Josephine, inzwischen verwitwete Gräfin von Deym zu ermöglichen. Therese war über beider Beziehung im Bilde und hielt die zwei für vom Himmel füreinander bestimmt. Beethovens Widmung der Klaviersonate könnte 1810 auch ein Dank für die große Loyalität und Selbstlosigkeit Thereses gewesen sein.
 Therese Komtesse von Brunswick (1775-1861), mit Beethoven befreundet, zeitweilig gar verlobt, und Gründerin des ersten ungarischen Kindergartens.akg-images / Beethoven-Haus Bonn
Therese Komtesse von Brunswick (1775-1861), mit Beethoven befreundet, zeitweilig gar verlobt, und Gründerin des ersten ungarischen Kindergartens.akg-images / Beethoven-Haus BonnBeethoven war den Brunswicks wie ein Familienmitglied. Franz, den Bruder der beiden Frauen, duzte er, trotz des Standesunterschieds. Ihm widmete er die Klaviersonate f-Moll op. 57, die „Appassionata“, mit einem Presto-Schluss „all’ongharese“. Es dürfte kein Zufall sein, dass die f-Moll- und die Fis-Dur-Sonate in Beethovens Schaffensbiografie aufeinanderfolgen. Schon für die „Appassionata“ ist der Tonartengegensatz f-Moll-Ges-Dur (enharmonisch identisch mit Fis-Dur) konstitutiv. Beide Sonaten gehören zusammen wie Bruder und Schwester.
Nach seinem ersten Konzert in Buda, am 7. Mai 1800, bei dem er sein C-Dur-Klavierkonzert op. 15 gespielt hatte, kam Beethoven zum ersten Mal nach Martonvásár, dem ungarischen Landsitz Graf Franz von Brunswicks, etwa vierzig Kilometer westlich von Budapest. Hier wurde er sofort der freien Geistesrepublik des familiären Lindenkreises einverleibt, wie Therese sich erinnerte, und machte mit den Geschwistern Musik: Franz war ein versierter Cellist, Therese eine begabte Sängerin, Dichterin und Malerin, Josephine Pianistin und Charlotte Gitarristin.
Zugleich waren die Brunswicks progressive, universell gebildete Aristokraten, die Ungarn in Kultur und Bildung voranbringen wollten. Vermutlich verbrachte Beethoven auch den gesamten August des Jahres 1806 in Martonvásár. Franz wollte den Freund, den er „Bruder“ nannte auch 1824, unmittelbar nach der Uraufführung von dessen neunter Symphonie nach Martonvásár holen. Wir wissen nicht, ob er Erfolg damit hatte. Falls ja, hätte Beethoven die Umgestaltung des schlichten barocken Gutshauses in ein neogotisches Schloss inmitten eines großen englischen Landschaftsgartens mit Teich und Insel noch erleben können. Er muss hier glücklich gewesen sein.
 Schloss Martonvásár ist umgeben von einem Landschaftspark im englischen Stil mit großem Teich und Insel.Jan Brachmann
Schloss Martonvásár ist umgeben von einem Landschaftspark im englischen Stil mit großem Teich und Insel.Jan BrachmannIn Martonvásár, das man von Budapest aus mit der Regionalbahn in weniger als einer Stunde erreicht, erinnert nicht nur ein klug, modern und interaktiv gestaltetes Museum an die Freundschaft Beethovens mit der Familie von Brunswick. Es gibt derzeit auch eine Sonderausstellung für Therese. Die wenigsten freilich wissen, dass im Nachbardorf Tordas, nur fünf Kilometer von Martonvásár gelegen und von dort mit dem Landbus 703 in acht Minuten zu erreichen, im Jahr 1733 der Mathematiker, Astronom und Sprachforscher János Sajnovics geboren wurde. An ihn erinnert kein Museum, aber ein Denkmal unweit des verfallenen Gutshauses und ein weiterer, halb verwitterter Gedenkstein. Dabei ist die Bedeutung von Sajnovics nicht weniger immens als die Therese von Brunswicks.

Der Jesuit ging 1769 als Assistent von Maximilian Hell, dem Direktor der Wiener Universitätssternwarte, nach Norwegen für astronomische Beobachtungen und folgte Hells Anregung, der Hypothese nachzuspüren, ob die Sprache der Samen in Lappland eventuell mit dem Ungarischen verwandt sein könne. Sajnovics verstand das Samische zwar nicht, aber ihm fiel etwas Wesentliches auf: Die Prosodie glich dem Ungarischen. Sie unterschied Stärke- und Längeakzente, weshalb beim Sprechen der charakteristische Synkopenrhythmus entsteht.
In den meisten indoeuropäischen Sprachen – mit Ausnahme des Tschechischen, das die ungarische Prosodie adoptiert hat – fallen Stärke- und Längeakzent zusammen. Ist das Französische endbetont, das Polnische immer auf der vorletzten Silbe, so haben das Russische, Deutsche oder Italienische variable Schwereakzente. Das Ungarische, Estnische und Finnische aber sind stets anfangsbetont, kennen darüber hinaus jedoch unterschiedliche Vokallängen auf den unbetonten Silben (im Finnischen und Ungarischen zwei, im Estnischen sogar drei Vokaldauern).
 Gedenkstein für den Mathematiker, Astronomen und Linguisten János Sajnovics (1733-1785) in seinem Geburtsort TordasJan Brachmann
Gedenkstein für den Mathematiker, Astronomen und Linguisten János Sajnovics (1733-1785) in seinem Geburtsort TordasJan BrachmannAll das wusste Sajnovics damals noch nicht, aber aufgrund rein klanglicher – wenn man so will: musikalischer – Eigenheiten der gesprochenen Sprache kam er der Verwandtschaft des Ungarischen und des Samischen auf die Spur. Nicht Syntax und Semantik, nicht Lexik und Grammatik konnten ihm weiterhelfen, allein der Klang, die Prosodie, der Rhythmus. Sein Essay „Demonstratio idioma ungarorum et lapponum idem esse“, also: „Nachweis, dass die Sprache der Ungarn und Lappen dieselbe ist“, markiert den eigentlichen Beginn der finnougrischen Linguistik. Die Arbeit erschien 1770, im Geburtsjahr Ludwig van Beethovens.
 Gedenktafel für den Mathematiker, Astronomen und Linguisten János Sajnovics (1733-1785) in seinem Geburtsort TordasJan Brachmann
Gedenktafel für den Mathematiker, Astronomen und Linguisten János Sajnovics (1733-1785) in seinem Geburtsort TordasJan BrachmannOb die Brunswicks davon wussten? Franz von Brunswick jedenfalls bat seinen Freund Beethoven, die Schauspielmusik zum Drama „König Stephan“ für die Eröffnung des neuen Deutschen Theaters in Pest am 9. Februar 1812 zu schreiben, mit der Erzherzog Franz Joseph Karl von Österreich für eine kulturelle Harmonisierung mit den Ungarn sorgen wollte. Beethoven nahm den Auftrag gern an. Textdichter dieses Festspiels, das Stephan, den Begründer des christlichen Königreichs Ungarn um das Jahr 1000 herum als Wegbereiter der Habsburgmonarchie feiern sollte, war August von Kotzebue, einst Präsident des Magistratsgerichts für ziviles Recht des Gouvernements Estland im Russischen Kaiserreich.
 Büste für den Mathematiker, Astronomen und Linguisten János Sajnovics (1733-1785) in seinem Geburtsort TordasJan Brachmann
Büste für den Mathematiker, Astronomen und Linguisten János Sajnovics (1733-1785) in seinem Geburtsort TordasJan BrachmannObwohl der Text auf Deutsch ist, versieht Beethoven sowohl den Orchesterpart im Frauenchor „Wo die Unschuld Blumen streute“ als auch den Schlusschor „Heil unsern Enkeln!“ mit der Prosodie des Ungarischen. Das Presto-Hauptthema der Ouvertüre gewinnt seine Prägnanz durch magyarische Synkopen. Man kann zu den Orchesterklängen ganz klar skandieren „Magyarország! Magyarország!“, also „Ungarn! Ungarn!“, mit dem deutlichen Gegensatz eines schweren, aber kurzen und dunklen A am Anfang und eines leichten, aber langen A am Ende. Beethovens Orchester spricht Ungarisch.
Der Komponist verschmilzt einen indoeuropäischen Text mit einer finnougrischen Prosodie. Das ist ein eminent politischer Akt, der den kaiserlichen Auftrag einer kulturellen Harmonisierung zwischen Österreich und Ungarn auf kreative Weise ernst nimmt.
Josephine von Brunswick heiratete nach dem Tod ihres ersten Mannes erneut, diesmal den baltendeutschen Baron Christoph von Stackelberg, Hauslehrer ihrer Kinder, ebenfalls Schüler Pestalozzis und bald darauf als Reformpädagoge Gründer der ersten Bauernschulen in Estland. Die Ehe war schnell zerrüttet. Josephines letzte Tochter Minona (spiegelbildlich: anonim) wurde am 9. April 1813 geboren. Zum Zeitpunkt ihrer Zeugung lebte Josephine von ihrem Mann getrennt – aber exakt auf diese neun Monate zuvor, den 6./7. Juli 1812 lässt sich Beethovens berühmter Brief „An die Unsterbliche Geliebte“ datieren. Minona von Stackelberg könnte mit großer Wahrscheinlichkeit Beethovens Tochter sein. Sie wuchs in Reval, der heutigen estnischen Hauptstadt Tallinn, auf.
Minona, Kotzebue, Sajonovics in Tordas, unweit von Martonvásár – die Nähe Beethovens zum finnougrischen Sprachraum ist verblüffend und sein „König Stephan“, mit dem er, „den Schnurrbärten, die mir von Herzen gut sind“, helfen wollte, ist vielleicht doch mehr als ein „Gelegenheitswerk“. Franz von Brunswick jedenfalls übernahm 1819 die Leitung des Pester Theaters, das mit der Musik seines Freundes eröffnet worden war, und heiratete 1823 die Pianistin Sidonie Justh – über Standesgrenzen hinweg. Therese von Brunswick, die Kinder liebte, aber nie welche hatte, überlebte alle ihre Geschwister. Sie starb 1861 und liegt begraben in Martonvásár.

 vor 2 Stunden
1
vor 2 Stunden
1





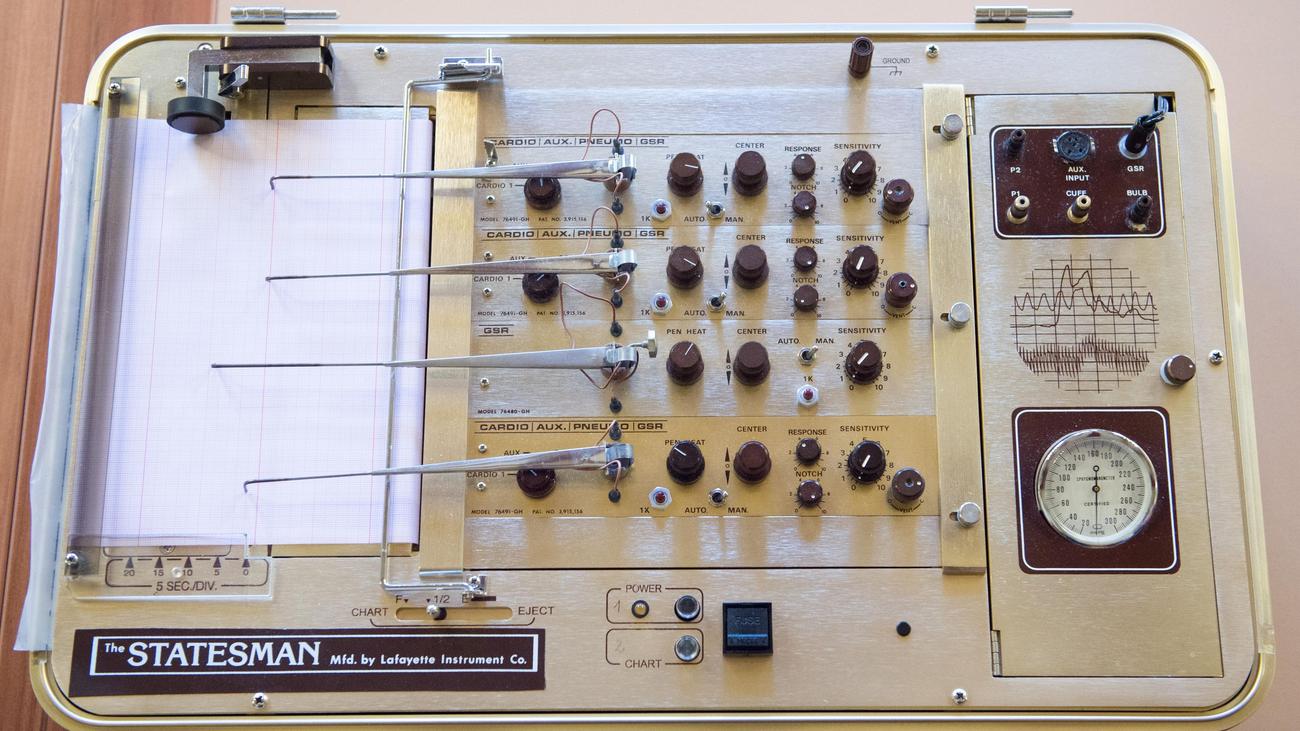





 English (US) ·
English (US) ·