Nach 59 Jahren erstmals auf Deutsch: Maria Judite de Carvalhos Roman "Leere Schränke"
Aus der ZEIT Nr. 33/2025 Aktualisiert am 11. August 2025, 20:03 Uhr

Dora Rosário lebt nicht im Hier und Jetzt. Sie lebt auch nicht im Gestern; sie lebt im Vorgestern, und wahrscheinlich wäre ihrer 17-jährigen Tochter Lisa selbst das noch nicht vorsintflutlich genug. Zehn Jahre ist ihr Mann jetzt tot. Eine Krankheit hatte ihn dahingerafft. Das passte, so schlaff und willenlos, so ganz ohne Ehrgeiz und Leidenschaft, wie er war. Da hatte der Tod leichtes Spiel. Er machte Dora Rosário mit Mitte dreißig zur Witwe. Gewissermaßen hat auch sie mit dem Tod ihres Mannes ihr Leben beendet. Sie, ihr Mann Duarte und Lisa, nur das allein zählte für Dora Rosário. Alle Menschen um sie herum, das waren die Anderen. "Die Anderen waren der Feind, von dem nichts Gutes, eher alles Schlechte zu erwarten war", so beschreibt es die in Lissabon geborene Schriftstellerin Maria Judite de Carvalho (1921–1998) in ihrem Roman Leere Schränke, der nun erstmals ins Deutsche übersetzt vorliegt.
In Portugal erschien er 1966. Dort hat sich Carvalho als Autorin von Romanen, Kurzgeschichten und Novellen längst einen Namen gemacht. Die Literaturkritik verglich sie mit Anton Tschechow und Katherine Mansfield. Carvalhos Erzählweise ist nicht nur minimalistisch und von funkelnder Ironie, sie ist spöttisch und scharfsichtig. Es geht auch hier um die großen Emotionen, aber die Autorin blickt auf Liebe, Verzweiflung, Enttäuschung und Verrat wie eine Pathologin und seziert alles mit ruhiger Hand.
Leere Schränke ist das Porträt einer Frau, die sich nach dem Tod ihres Mannes zwar als handlungsfähig und zupackend erweist, innerlich aber längst erloschen ist; die vielleicht sogar nie für etwas brannte, am wenigsten für sich selbst. Im Portugal der Sechzigerjahre – die Salazar-Diktatur nähert sich ihrem Ende – erfüllt sie alle Vorstellungen eines konventionellen Ehelebens. Sie bewegt sich folgsam an der Seite ihres Mannes und tritt dabei ganz beiläufig die kleinen Feuer in ihrem Innern aus. Lodert doch noch einmal Glut auf, weiß Duarte es mit seinen Reden über die bestialische Gesellschaft zu ersticken. Er hat es zu nichts gebracht und verbirgt sein Scheitern hinter der Maske des ewig nörgelnden und alles durchschauenden Gutmenschen. Dora liebt ihn, widerspricht nicht und verschweigt ihre eigenen Gedanken, um Duarte nicht zu verletzen: "Er war ein guter Mann, ein unverdorbener Mann, gefeit gegen die Schlechtigkeit und Gier der Welt. Er ließ sich nicht verderben. Und ein wenig verachtete Dora sich selbst für ihre kritischen Gedanken, die sie sogar ihm gegenüber hegte, weil sie nicht uneingeschränkt an seine Idole glaubte, weil sie seine Heiligkeit nicht noch mehr bewunderte, weil sie mit einem heimlichen Lächeln das unsichtbare Podest betrachtete, auf das er sich selbst gestellt hatte." Zehn Jahre nach dem Tod ihres Mannes wirkt sie selbst nur noch wie ein Häuflein Asche inmitten seiner Devotionalien. Das Leben ohne Duarte ist ihr eine Wüste, die Einsamkeit ihr bester Freund. Mit Ende dreißig ist sie weder besonders hübsch noch besonders hässlich. Sie ist etwas viel Schlimmeres: Sie ist unscheinbar.
Maria Judite de Carvalho ist eine raffinierte und, ja, sie ist eine skrupellose Erzählerin, die ihre Geschichte so weit treibt, dass Unscheinbarkeit noch das Beste gewesen wäre, was man Dora Rosário zum Schluss hätte wünschen können. Mit kühlem Witz, scharfer Beobachtungsgabe und zuweilen erschreckend sachlich zeichnet die Autorin das Schicksal einer Frau, die sich neben einer willensstarken Tochter, einer heiteren Schwiegermutter und einer leicht verrückten Tante, die an Ufos glaubt, in ihrem Leben als Witwe eingerichtet hat.
Bis sie eines Tages von ebendieser heiteren Schwiegermutter zu nächtlicher Stunde erfährt, dass ihr über alles geliebter Duarte sie verlassen wollte, um mit einer anderen Frau zusammenzuleben. Die Szene könnte kaum grausamer beschrieben werden. Nicht weil der Leser mit Dora Rosário leiden würde; es ist die Ungerührtheit und Beiläufigkeit, mit der die alte, dicke, auf dem Sofa zerfließende Schwiegermutter es ihr erzählt. Zum Schluss dreht sie sich auf die andere Seite und sagt: "Ich glaube, ich werde nun ein wenig schlafen. Warum tust du es mir nicht gleich?"
Aber Dora Rosário erwacht. Sie kauft sich neue Kleider, geht zum Friseur und schminkt sich. Sie gibt sich weltoffen und verlässt ihre Einsamkeit. "Meine Güte! Was ist denn mit dir passiert?", jubelt die Tochter. "Unglaublich! Phantastisch!" Sie habe fast schon Komplexe bekommen. Doch wenn der Klappentext von Dora Rosário als einer Frau spricht, die alle überrascht, sich öffnet und den Gefühlen freien Lauf lässt, so stimmt das nur bedingt. Eigentlich stimmt es gar nicht. Ihre Veränderung wird zwar bemerkt, aber nicht ganz ernst genommen. Ihre plötzliche Weltoffenheit wirkt linkisch und einstudiert, und der freie Lauf der Gefühle entpuppt sich als Irrweg. Hat man Mitleid mit ihr? Keineswegs.
Überhaupt kann man sich für keine Figur in diesem Roman so recht erwärmen, aber das hat einen literarischen Reiz. Während Dora Rosário eine unscheinbare, dem Leben abgewandte Figur ist, so ist ihre Tochter Lisa das Gegenteil: attraktiv, lebensfroh und erschreckend wendig. Anfangs eine Nebenfigur, entwickelt sie sich zu einer maliziösen Spielerin, die alle im Griff hat. "Ihre Tochter schien über das Leben Bescheid zu wissen, noch bevor sie es gelebt hatte, schien von allen Ängsten befreit, noch bevor sie Angst empfunden hatte. Die Dinge waren für sie selbstverständlich, als hätte sie bereits alles durchdacht und sich eine Meinung gebildet." Zwar hat sie zur Mutter ein gutes Verhältnis, aber in ihren Fragen und ihrem Gebaren schwingt auch immer ein wenig Verachtung mit. Kalt und rücksichtslos bemerkt sie: "Aber die Jugend, wo ist sie hin? Sie ist doch verloren. Ich meine … du zum Beispiel. Jetzt siehst du viel jünger aus, ausgezeichnet. Aber hast du das Leben ausgekostet? Bis jetzt, meine ich …" In den Gesprächen mit ihrer Tochter schrumpft Dora Rosário zu einer Schülerin, die durch die Prüfung fällt. Nicht weil sie den Stoff nicht genügend gelernt hätte; er ist ihr gar nicht vertraut.
Carvalho seziert das Zusammenspiel dreier Generationen. Eine stammt aus einer untergegangenen Zeit, in der die Schwiegermutter mit ihrem hohen perlenbesetzten Spitzenkragen wie ein stumpfer Dolch steckt; eine kommt aus der gegenwärtigen Zeit, in der Dora Rosário sich einsam, unsicher und betrogen fühlt; und dann ist da noch die Tochter Lisa, die der Großmutter still bewundernd, berechnend entgegengeht, um nicht so leben zu müssen wie ihre Mutter. Es wird ihr gelingen, und Dora Rosário wird einen hohen Preis bezahlen.
Vor dem Hintergrund dumpfer politischer Umstände hat Maria Judite de Carvalho eine Figur erschaffen, die nichts erlebt und alles erduldet, die sich in ihrer Passivität wie in einem Tempel eingerichtet hat und die erkennen muss, dass sie die Spielregeln des Lebens nicht mehr beherrscht. Zu spät wird ihr bewusst, dass auch die Nächsten die Anderen sind.
Maria Judite de Carvalho: Leere Schränke. Roman; aus dem Portugiesischen von Wiebke Stoldt; S. Fischer, Frankfurt am Main 2025; 160 S., 24,– €, als E-Book 18,99 €

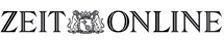 vor 3 Stunden
1
vor 3 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·