Herr Klüssendorf, die Kommunalwahlen 2020 in Nordrhein-Westfalen gingen dramatisch aus, dieses Mal war es nur noch ein bisschen schlechter. Sieht so mittlerweile für die SPD ein Erfolg aus?
Natürlich ist das Ergebnis kein Erfolg. Aber wir sehen nicht nur Tiefen, sondern auch Höhen. In vielen Städten und Gemeinden haben wir gut abgeschnitten, es gibt auch viele Oberbürgermeisterwahlen, bei denen wir gute Ergebnisse erzielt haben. Die steigende Zustimmung für die AfD macht mir Sorgen, auch wenn sie nicht so stark ausgefallen ist wie manche das vorher prophezeit haben.
„Kein Erfolg“ klingt nach einer freundlichen Beschreibung dafür, dass die SPD in ihrer einstigen Herzkammer klinisch tot war und jetzt die Wiederbelebung nicht geklappt hat.
Bei allem Respekt, aber da muss ich widersprechen. Wir stellen viele Bürgermeister und führen in den Räten mehrheitsfähige Konstellationen mit an. Wir stehen in Umfragen bundesweit bei um die 15 Prozent. In Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt landesweit 22 Prozent geholt. Das ist uns zu wenig, aber wir sind ganz sicher nicht klinisch tot.
Und trotzdem zeigt das Ergebnis, dass die SPD mit ihrer Politik einfach nicht mehr überzeugt. Was heißt das für den Herbst der Reformen: Werden Sie jetzt zu mehr Zugeständnissen an den Koalitionspartner bereit sein – oder zu weniger?
Wir haben klare Verabredungen, was wir als nächstes machen wollen. In der Debatte um die Sozialsysteme sage ich: Die SPD ist reformwillig. Ich bin dafür, konsequent alle steuerfinanzierten Sozialleistungen für die Bürgerinnen und Bürger in einem einzigen System zusammenzuführen. Die ganze Infrastruktur, wer ist für was zuständig, wer ist antragsberechtigt, bei welchem Amt muss ich mich melden, auf welche Leistung habe ich Anspruch, das muss unbedingt zusammengeführt werden. Das wäre endlich ein lang ersehnter Fortschritt und würde übrigens auch viel Geld sparen.
Alle Fachleute fordern seit Jahren unisono genau das: Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, alles soll in ein System. Doch das wäre eine Mammutreform. Ist sie in einer Legislaturperiode überhaupt zu schaffen?
In einer Demokratie muss so eine Reform schaffbar sein. Es wäre schon ein großer Schritt, wenn wir ein festes Ziel mit konkreten Meilensteinen vereinbaren, zum Beispiel das Jahr 2035. Wir sollten mutig und ambitioniert sein.
Wir müssen endlich an die Multimillionen- und Milliardenerbschaften ran.
Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär
Sie reden über Strukturen. Aber was ist mit Leistungskürzungen – kommen die für die SPD überhaupt in Frage?
Uns bewegt, das System einfacher und besser zu machen. Wir haben zu viel Bürokratie und Zuständigkeiten-Wirrwarr. Und das Ziel ist, Menschen nachhaltig zurück in Arbeit zu bringen. Nur das hilft am Ende. Die pauschale Forderung nach Leistungskürzungen wird der Herausforderung nicht gerecht und engt die Debatte zu stark ein.
Nordrhein-Westfalen ist in der Debatte ums Soziale ein gutes Beispiel. In Gelsenkirchen ballen sich die Probleme beim Thema Bürgergeld. Die Leute sind wahnsinnig frustriert, sie haben das Gefühl, sie müssen schuften, andere kriegen Geld hinterhergeworfen. Und die AfD bekommt 30 Prozent.
Das Gefühl haben sicher einige Menschen, und genau um diese Themen kümmern wir uns gerade. Die SPD verschließt vor dieser Stimmung nicht die Augen. Wenn es darum geht, welche Kraft im Ruhrgebiet noch gegen Populismus und einfache Antworten bestehen kann, dann sind es die Sozialdemokraten, die dort als Kümmerer wahrgenommen werden.
Mehr Politik sehen Sie hier
In Sachen Erbschaftssteuer ist plötzlich Bewegung drin, Jens Spahn prangert die ungleiche Verteilung von Vermögen an. Bald ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten. Was sind Ihre Vorschläge?
Die Sonderregeln bei der Erbschaftssteuer für Betriebsvermögen über 26 Millionen Euro müssen weg. Wer ein Unternehmen erbt, das so viel wert ist, muss Verantwortung übernehmen. Stattdessen erben und vererben die Allerreichsten derzeit fast immer steuerfrei. Aber wir müssen mit noch mehr Dingen aufräumen, die historisch gewachsen sind und einfach nicht mehr in die Zeit passen.
Woran denken Sie?
Es ist aus der Zeit gefallen, dass sich Freibeträge allein an der verwandtschaftlichen Blutlinie bemessen und diese Freibeträge regelmäßig neu ausgeschöpft werden können. Warum überlassen wir es den Menschen nicht selbst festzulegen, wer ihnen am nächsten steht? Das geht besser und gerechter. Derzeit kann ein Elternteil alle zehn Jahre 400.000 Euro steuerfrei an ein Kind verschenken oder vererben. Superreiche beginnen damit systematisch, wenn ihre Kinder noch sehr klein sind, so kommen im Laufe eines Lebens riesige Summen zusammen, die steuerfrei übertragen werden. Das ist unfair und gehört beendet.
Was wollen Sie stattdessen?
Ich bin für einen Lebensfreibetrag bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Es würde dann eine bestimmte Summe X geben, die ein Mensch in seinem Leben erben oder geschenkt bekommen kann ohne Steuern zu zahlen. Alles darüber hinaus wird konsequent besteuert.

© picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
Welche Größenordnung sollte dieser Lebensfreibetrag haben?
Klar ist: Mittlere und kleine Erbschaften müssen geschützt bleiben. Aber wir müssen endlich an die Multimillionen- und Milliardenerbschaften ran. Über die Hälfte der Menschen in Deutschland erbt gar nicht, leistungsgerecht ist das nicht.
Wenn Sie durch so eine Reform erreichen wollen, dass mehr Erbschaftssteuer gezahlt wird, kann der Lebensfreibetrag nicht allzu weit weg sein von den 400.000 Euro, die derzeit alle zehn Jahre als Freibetrag fürs Schenken oder Erben zur Verfügung stehen.
Aus meiner Sicht ist es denkbar, den Entwicklungen der letzten Jahre Rechnung zu tragen und über eine moderate Erhöhung der bisherigen Freibeträge nachzudenken. Nochmal: Mir geht es darum, das Ausnutzen durch Steuergestaltung zu eliminieren und die allerhöchsten Vermögen in den Blick zu nehmen. Die breite Mitte der Gesellschaft soll dagegen entlastet und nicht belastet werden.
Viel diskutiert in diesem Zusammenhang ist das berühmte Reihenhäuschen im Münchner Umland, das mehr als eine Million Euro wert ist.
Wer selbst einzieht, erbt dieses Häuschen schon heute steuerfrei – das wollen wir auch beibehalten. Und wenn der Erbe nicht einziehen will und das Haus rein als Vermögenswert betrachtet, finde ich es weiterhin vertretbar, dass dieser Wert versteuert werden muss. Etwas komplizierter wird es bei großen Mietshäusern, zum Beispiel auch in München, die sechs oder sieben Millionen Euro wert sind. Da kann ich mir vorstellen, die Erbschaftssteuer an die Mieten zu koppeln.
Wer die Mieten als Erbe nicht erhöht, zahlt weniger Erbschaftssteuern?
Wer sich als Erbe verpflichtet, zum Beispiel nur die ortsübliche Miete zu nehmen oder eine bestimmte Steigerungsrate bei den Mieten nicht zu überschreiten, könnte Nachlässe bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer bekommen.
Was muss bei einer Erbschaftssteuerreform unterm Strich rauskommen?
Ein zweistelliger Milliardenbetrag ist realistisch. Ein zweites Thema wäre dann die Reaktivierung der Vermögenssteuer. Es gibt riesige Vermögen, die pro Jahr locker sechs bis acht Prozent Rendite abwerfen, ohne dass die Besitzer je etwas dafür geleistet hätten. Wenn hier moderat mit ein bis zwei Prozent auf das Nettovermögen besteuert würde, wäre das nur gerecht und in jedem Fall leistbar.
Haben Sie Hoffnung, dass der Koalitionspartner auch bei der Vermögenssteuer noch flexibel wird? Man sollte nichts ausschließen – auch wenn meine Hoffnung dahingehend, ehrlich gesagt, begrenzt ist.

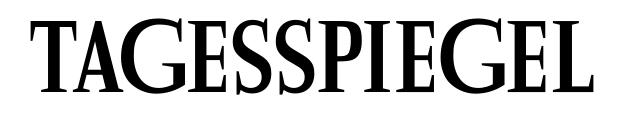 vor 1 Tag
1
vor 1 Tag
1











 English (US) ·
English (US) ·