Frankreichs Ankündigung, Palästina anzuerkennen, sorgt in Israel für Wut und Spott. Den Menschen in Gaza und dem Westjordanland dürfte das Vorhaben wenig bringen.
25. Juli 2025, 16:07 Uhr

Eigentlich hatte sich Benjamin Netanjahu diese Woche rar gemacht. Am Sonntag meldete sich Israels Premier wegen einer Lebensmittelvergiftung krank. Ausgerechnet in der letzten Parlamentswoche vor der fast dreimonatigen Sommerpause, also in den letzten Tagen, die Netanjahu ohne kompletten Koalitionsbruch überstehen muss, um sich seine Macht bis mindestens in den Herbst zu sichern. Überlebt er diese Woche politisch, könnte es frühestens Anfang 2026 Neuwahlen geben.
Dass die Verhandlungen über ein neues Gaza-Abkommen seit Wochen stocken? Netanjahu sitzt die Situation aus, erklärte lediglich, wie später auch der US-Nahostgesandte Steve Witkoff, die Bedingungen der Hamas seien nicht akzeptabel. Dabei haben Recherchen der New York Times längst aufgedeckt, dass Netanjahu den Gazakrieg aus Machtkalkül in die Länge zieht. Weder den extremen Hunger in Gaza noch die Forderung nach einem Ende der Kämpfe durch 28 westliche Staaten bedachte der israelische Regierungschef mit einer Reaktion. Erst als Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Donnerstag ankündigte, Palästina als Staat anzuerkennen, meldete sich Netanjahu umgehend zu Wort: "Ein palästinensischer Staat unter diesen Bedingungen wäre eine Startrampe zur Vernichtung Israels", teilte sein Büro mit.
Netanjahu dürfte wissen, dass ihm die Ankündigung Frankreichs innenpolitisch helfen kann. Zwar ist die Mehrheit der Israelis laut Umfragen mittlerweile für ein Kriegsende in Gaza. Aber anstatt über die Kriegsführung und die fehlenden Reaktionen Netanjahus zu diskutieren, lenkt Macrons Aussage die Aufmerksamkeit auf ein Thema, bei dem sich die meisten Israelis einig sind, unabhängig davon, ob sie Netanjahu unterstützen oder nicht. Nach dem verheerenden Hamas-Angriff am 7. Oktober vor bald zwei Jahren ist das Misstrauen in die palästinensischen Nachbarn groß wie nie, die meisten lehnen mehr Souveränität, geschweige denn einen eigenen palästinensischen Staat entschieden ab. Entsprechend sorgt Macrons Ankündigung dafür, dass Netanjahu ein paar Beliebtheitspunkte sammeln könnte und die Opposition in die unglückliche Situation gerät, dem Premier in der Sache zuzustimmen. So nannte etwa Oppositionsführer Jair Lapid auf der Plattform X die Entscheidung des französischen Präsidenten einen "moralischen Fehler und diplomatischen Schlag" für Israel. "Die Palästinenser sollten nicht für die Angriffe vom 7. Oktober oder ihre Unterstützung der Hamas belohnt werden."
"Wie clever!", ätzt der US-Botschafter
In Israel hat sich nach bald zwei Jahren Nahostkrieg eine Routine entwickelt, auf die blinden Flecken der internationalen Kritik hinzuweisen. Mit Blick auf Macron wird etwa auf die Geschichte erinnert: Frankreich trägt historisch eine Mitverantwortung für die chaotische Lage im Nahen Osten, teilte sich nach dem Ersten Weltkrieg mit Großbritannien die Gebiete wie Kuchenstücke auf. Im Zweiten Weltkrieg bewaffnete das Vichy-Regime Frankreichs dann heimlich jüdische Untergrundgruppen im britischen Mandatsgebiet Palästina, die damit die britischen Soldaten angriffen und Unruhen schürten, wie der britische Historiker James Barr aufgedeckt hat. Diese Einmischung Frankreichs "markierte den Höhepunkt eines Kampfes um den Nahen Osten, der seit 30 Jahren andauerte", schreibt Barr dazu in seinem 2011 veröffentlichten Sachbuch A Line in the Sand.
Macrons Ankündigung sorgt deshalb nicht nur für Wut, sondern auch für Spott. "Wie clever! Wenn Macron einfach die Existenz eines Staates 'erklären' kann, kann Großbritannien vielleicht Frankreich zu einer britischen Kolonie 'erklären'!", schrieb etwa der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, auf X. Sachlichere Kritik kommt dagegen aus Großbritannien. "Wir wollen einen palästinensischen Staat, wir wünschen ihn uns, und wir wollen sicherstellen, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich eine solche langfristige politische Lösung entwickeln kann", sagte Peter Kyle, Minister für Wissenschaft und Technologie, dem Nachrichtensender Sky News am Freitag. "Aber jetzt, heute, müssen wir uns darauf konzentrieren, was das Leid lindern kann, und es ist das extreme, ungerechtfertigte Leid in Gaza, das für uns heute Priorität haben muss."
Was eine Anerkennung Palästinas bewirken kann
Tatsächlich ist die dringendste Frage, wie das Sterben in Gaza gestoppt werden kann. Ob die Anerkennung Palästinas als Staat dabei hilft, ist fraglich: Im vergangenen Jahr erklärten bereits Irland, Norwegen, Spanien und Slowenien, Palästina als Staat anzuerkennen. Wie die norwegischen Politikwissenschaftler Erling Lorentzen Sogge und Jørgen Jensehaugen für das Osloer Institut für Friedensforschung PRIO analysierten, markiert die Anerkennung einen Strategiewechsel der europäischen Nahostpolitik. Dies deute "darauf hin, dass sich die europäischen Staaten zunehmend bewusstwerden, dass ihre Idee der Friedensdiplomatie – die sich bisher darauf konzentrierte, das Bekenntnis zu einer Zweistaatenlösung zu bekräftigen, ohne viel zu tun, um diese voranzutreiben – nur sehr wenig bewirkt hat", schreiben die Autoren. Statt "die Aussicht auf einen eigenen Staat als Belohnung für Verhandlungen" gehe es nun darum, die "Anerkennung als Mittel zur Wiederaufnahme der Verhandlungen" einzusetzen.
Bei dem Beispiel Norwegen führte dieser Strategiewechsel allerdings zum einen dazu, dass die Regierung in Oslo ihre diplomatische Vertretung Al-Ram im Westjordanland 30 Jahre nach ihrer Eröffnung schließen musste. Zuvor hatte Israel den für die palästinensischen Gebiete zuständigen norwegischen Diplomaten den Status entzogen. Diplomatische Vertretungen im besetzten Westjordanland sind wesentliche Anker in der Förderung von Bildung, Wirtschaft und der Unterstützung der Zivilgesellschaft vor Ort.
Außerdem kippte Israel ein gemeinsames Abkommen mit Norwegen über finanzielle Hilfen für die Palästinenser. Zum Hintergrund: Laut der Osloer Friedensverhandlungen aus den 1990er-Jahren nimmt Israels Finanzministerium die Steuergelder der Palästinensischen Autonomiebehörde PA ein, überweist diese jeden Monat weiter. Israels Finanzministerium ist damit auf Basis der Osloer Abkommen weiterhin eine der wichtigsten Säulen für die finanzielle Versorgung der Palästinenser. In der aktuellen Regierung untersteht das Ministerium aber Bezalel Smotrich, einem Vertreter der extremen Rechten und der radikalen Siedlerbewegung.
Nach dem 7. Oktober wollte Smotrich die Gelder nur noch anteilig überweisen, um damit nicht die Hamas im Gazastreifen indirekt zu fördern, hieß es. Das führte zum Protest der PA. Im Januar 2024 einigte man sich darauf, die Überweisungen über Norwegen als treuhändischen Vermittler zu regeln. Als Norwegen dann Palästina anerkannte und Israel das Abkommen kippte, verfügte die Regierung in Oslo noch über umgerechnet rund 420 Millionen US-Dollar palästinensischer Steuereinnahmen, die laut israelischer Verordnung aber nicht mehr an die PA überwiesen werden durften. Erst Anfang dieses Jahres schlichteten PA und Israel den Streit und einigten sich darauf, ab sofort wieder ohne Vermittler zu arbeiten.
Das Beispiel Norwegen zeigt: Es ist unwahrscheinlich, dass Macrons Initative den Palästinensern mehr als symbolischen Rückhalt bietet. Mahmoud Abbas, Präsident der PA, begrüßte die Entscheidung zwar als "Sieg für die palästinensische Sache". Diese spiegele "das Engagement Frankreichs für die Unterstützung des palästinensischen Volkes und seiner legitimen Rechte auf sein Land und seine Heimat wider", sagte Abbas am Freitag. Lob kam allerdings auch von der Hamas. In einer Erklärung forderte die Terrororganisation, dass andere Länder in Europa Frankreich folgen sollten.
Tatsächlich steigt der internationale Druck auf Israel merklich. Am Freitag kündigte die Armee an, wieder mehr humanitäre Hilfen nach Gaza zu lassen. Der Kurswechsel war nach Informationen der ZeitungHa’aretz aber bereits vor Macrons Ankündigung beschlossen worden.

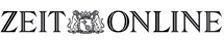 vor 18 Stunden
1
vor 18 Stunden
1











 English (US) ·
English (US) ·